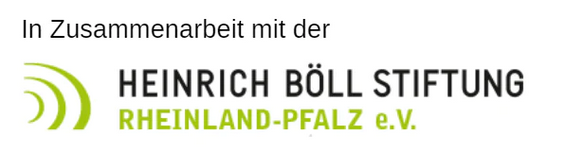Für die Mitarbeit in dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt FairWeg: Fairanstalten für alle! suchen wir von der Lokalen Agenda 21 Trier ab dem 18.03.2024 eine:n Werkstudent:in (m/w/d) mit einem Stellenumfang von bis zu 18h/Woche.
Die Lokale Agenda 21 setzt sich für nachhaltigen Wandel in Trier und der Region ein. Seit 1999 sind wir mit Projekten und Ideen für eine zukunftsfähige Stadt aktiv.
Kern des bis Sommer Ende Juli 2025 laufenden Projekts ist es, gemeinsam Barrieren auf Veranstaltungen abzubauen und so Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen. Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit stehen hier im Vordergrund.
Inhalt des Projektes
Kern des Projekts ist die Erarbeitung und Durchführung einer Fortbildungsreihe zu inklusiven Events für Veranstaltende. Die Teilnehmenden erfahren bauliche, akustische, visuelle und sprachliche Barrieren am eigenen Leib und werden von Menschen mit Behinderungen dabei unterstützt, Barrieren abzubauen. Die ersten beiden Workshops zum Thema Hören und Sehen konnte bereits jeweils einmal erfolgreich durchgeführt werden. Für die kommende Projektarbeit werden Workshops zu den Themen Mobilität und Kommunikation geplant, sowie Wiederholungen der Workshops Hören und Sehen.
Darüber soll ein Praxishandbuch "Inklusiv Fairanstalten" mit Vorlagen, Checklisten und Praxistipps erstellt werden - als Umsetzungshilfe für den Leitfaden Nachhaltige Veranstaltungen der Stadt Trier.
Eine breitere Öffentlichkeit erreichen wir durch Infoveranstaltungen, Social Media-Kampagnen und die FairWeg-Kneipenquizze, bei denen Menschen in lockerer Atmosphäre zusammenkommen und sich spielerisch mit Inklusionsfragen beschäftigen.
Arbeitsbereich
Die Mitarbeit innerhalb des vierköpfigen Projektteams ist bewusst vielseitig und flexibel angelegt, wichtige Arbeitsfelder sind in jedem Fall:
Haupteinsatzort ist die Geschäftsstelle der Lokalen Agenda 21 Trier.
Anforderungen
Wir suchen Studierende aller Fachbereiche, die sich mit den Zielen des Projekts und dem Profil der Lokalen Agenda 21 identifizieren können. Erste Erfahrungen in der praktischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Journalistisches Schreiben, Content-Erstellung für Social Media, Umgang mit gängiger Grafiksoftware und WordPress) sind von Vorteil. Organisationstalent, Selbstständigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit sind ebenfalls ein großes Plus.
Bewerbung
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf in einem PDF-Dokument bis Montag, 01.03.2024 per Mail an Sophie Lungershausen (lungershausen@la21-trier.de).
Mehr Informationen zur Lokalen Agenda 21 gibt es unter la21-trier.de.
Endlich ist es wieder so weit: Nach ausverkauftem Haus mit fast 150 von euch beim letzten mal sind wir endlich wieder mit dem besten Kneipenquiz diesseits und jenseits der Großregion am Start! Und auch diesmal dreht sich (fast) alles um Barrierefreiheit und Inklusion, unter unserem Motto „Agenda-Quiz – Fair Quizzen Für Alle!“.
Wir freuen uns schon riesig, euch alle wieder zum supergemütlich-winterlichen Quizzen am Donnerstag, dem 07. Dezember ab 19.30 Uhr im PROUD des SCHMIT-Z begrüßen zu dürfen.
Natürlich gibt es für euch auch diesmal wieder großartige, einzigartige, beinahe unbezahlbare Preise aus Trier und der Region zu ergattern! Unter anderem...

Schaut doch regelmäßig bei Instagram rein, um keinen Gewinn und Tipp zu verpassen - im Story-Highlight gibt's alle Tipps jederzeit zum Nachlesen.
Wie gewohnt erwartet euch ein breit gefächertes Quiz mit fairtastischen Fragen rund um Trier, Nachhaltigkeit und Inklusion. Mitmachen könnte ihr mit eurem Team mit bis zu 8 Teilnehmer:innen und am besten mit einem fairtastischen Team-Namen.
Auf die Gewinner:innen des Abends warten wieder besondere Gewinne aus Trier und der Region - dazu bald mehr an dieser Stelle!
Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und das Quiz wird etwa 3 Stunden dauern. Der Veranstaltungsort ist mit einem Rollstuhllift eigenständig erreichbar, die Bar ist ebenerdig und mit einer barrierefreien Toilette ausgestattet. Bitte beachtet, dass wir KEINE Tischreservierungen anbieten, bitte seid früh genug da. Wir freuen uns, auf einen tollen Quiz-Abend für alle!




In unserer Themenwoche „Wo geht's hier weiter?“ wollen wir neue Ideen und Projekte vorstellen, die sich für ein inklusiveres und barriereärmeres Trier einsetzen. Heute wollen wir euch deshalb „TACHELES– das inklusive Medien-Team“ und ihre Arbeit für eine insgesamt inklusivere Medienlandschaft vorstellen.
TACHELES ist eine kleine Medienteam der Lebenshilfe Trier gefördert durch die Aktion Mensch in der Schönborn Straße, die gemeinsam Medieninhalte produzieren. In der Tacheles Redaktion ist Inklusion Alltag: Hier arbeiten insgesamt zehn Menschen mit und ohne kognitive Behinderung zusammen, um gemeinsam über Neues zu berichten. Die Themen erarbeitet die Redaktion gemeinsam in den (fast) wöchentlichen Redaktionssitzungen und es wird über alles Relevante berichtet, von Politik über Buntes und Kultur bis Soziales ist alles dabei.
Auch die Art und Weise ihrer Veröffentlichung wird inklusiv gemacht. Damit Tacheles für möglichst alle zugänglich ist, haben sie eine vielseitige Form der Veröffentlichung entwickelt: Beiträge werden auf schwerer und an allererste Stelle in leichter Sprache veröffentlicht und können auf der Homepage direkt vorgelesen werden. So werden all ihrer Beiträge für viel mehr Menschen zugänglich. Videos und Reels werden nebenbei auch für Instagram, Facebook und YouTube produziert. Beiträge können sich auch im Podcast angehört werden. Genau diese crossmediale Berichterstattung ermöglicht die Zugänglichkeit für ein möglichst breites Publikum.
Das TACHELES-Team setzt sich nicht nur in ihrer eigentlichen Redaktionsarbeit für die gelebte Inklusion ein, sondern zeigt mit seiner Berichterstattung, was in Trier möglich ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Immer wieder überprüfen sie verschiedenste Orte auf Barrierefreiheit: In ihrem Barrierecheck des Moselstadions Triers Ende 2021 konnte das TACHELES-Team einige Barrieren finden, wie die unbeweglichen Toiletten, zu hohe Tische an der Imbissbude oder nicht überdachte Rollstuhlplätze. Nach der Veröffentlichung ihres Berichtes reagierten die Bürgermeisterin Elvira Garbes und der Supporters Club Trier, die Fanszene der Eintracht Trier. Die Fanszene sammelte zahlreiche Spenden, um Barrieren im Moselstadion abzubauen. Dank der Spenden konnten neue Tische an den Essbuden angeschafft werden, damit jetzt alle ihr Essen und Getränke während des Spiels genießen können. Und auch die Stadt hat gehandelt und im Sommer 2022 für den Bau von vier neuen überdachten Rollstuhlplätzen gesorgt.
Und nicht nur das Stadion in Trier wurde auf Barrierefreiheit geprüft, auch in den Wahllokalen oder in den Bussen der SWT ist TACHELES regelmäßig unterwegs. Tacheles zeigt ganz praktisch, wo es für Trier hingehen kann und sollte. Auch Politik darf in der Berichterstattung nicht zu kurz kommen: So erklärt Tacheles gemeinsam mit einem Dozent der Universität Trier den Angriffskrieg auf die Ukraine oder macht aufmerksam auf den 05. Mai, dem Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Entstanden ist die Idee für Tacheles 2017 als zwei Redakteure gemeinsam über die Special Olympics berichtet haben. Die Special Olympics sind die olympischen Spiele für Menschen mit einer Mehrfachbehinderung und finden diesen Sommer in Berlin statt. Daraus entwickelt sich das Projekt, dass seit 2021 von der Aktion Mensch gefördert wird. Auch dieses Jahr wird TACHLESwieder über die Special Olympics berichten und vor Ort in Berlin sein und für spannende Berichte aus der Hauptstadt sorgen.
Das große Ziel von Tacheles ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Themen, das Leben und das Wirken von Menschen mit Behinderung und das ganz praktisch vor Ort. So setzt Tacheles sich für mehr gelebte Inklusion auch in der Medienlandschaft ein. TACHELES zeigt, was in Trier möglich ist und wir freuen uns deshalb umso mehr, TACHELES als unseren offiziellen Medienpartner für das FairWeg-Projekt mit dabei zu haben. Mehr zu Tacheles findet ihr auf ihrer Homepage.

Die närrische Zeit hat auch in unserem FairWeg-Büro Einzug gehalten. Kostümiert und bestens informiert sprechen unsere Redakteur:innen Lea, Svantje und Adrian nicht nur miteinander, sondern vor allem auch mit unserem Gast Julia (ihres Zeichens Rheinländerin und Büro-Jeck Nummer Eins) darüber, welches Potential Fasching in puncto Inklusion hat - und wie wir gemeinsam etwas gegen Sexismus, rassistische Traditionen und Diskriminierung im Allgemeinen tun können.
Hört gerne hier rein in die Auftakt-Folge für unsere neue FairWeg-Themenwoche. Unter dem Motto "Wo geht´s hier weiter?" hat das FairWeg-Team einige spannede Einblicke diese Woche vorbereitet.
Zu Beginn des neuen Jahres, wollen wir die Zeit nutzen, um auf eines unserer Highlights des vergangenen Jahres zurückzublicken: Am dritten Dezember durften wir den einzigen ersten Bundesligisten in Trier, die Doneck Dolphins, in ihrer Heimhalle, der Mäusheckerhalle, besuchen. Und hatten die Gelegenheit mehr zum Sport Rollstuhl-Basketball an sich und dem Team der Dolphins zu lernen, um im Anschluss beim Spiel gegen den BBC Münsterland mitzufiebern.
Bereits seit 1985 wird im Verein Rollstuhl-Basketball gespielt. Gegründet wurde der Verein durch Otmar Paßiwan, der bis heute noch der erste Vorsitzende des Vereins ist. Und keine zehn Jahre nach der Gründung gelang den Dolphins der Aufstieg in die erste Bundesliga, wo sie bis heute (bis auf eine kurze Pause in der zweiten Bundesliga von 2001 bis 2003) noch platziert sind. Dirk Paßiwan, Sohn des Mitgründers, ist Trainer und Spieler in der Mannschaft und zusätzlich noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft der Frauen. Also bis heute ein erfolgreicher Verein hier bei uns in der Region.

Auch die Jugendarbeit kommt bei den Dolphins nicht zu kurz: Eine eigene Jugendmannschaft gibt es seit 1997, die bis heute trainiert. Und auch die Bildungsarbeit kommt nicht zu kurz: Spieler:innen fahren an Schulen, um dort mit Kindern gemeinsam Basketball zu spielen.
Dabei ist die Grundlage des Vereins die menschliche Nähe, die man spätestens beim Betreten der Halle spürt. Egal ob vor, während oder nach dem Spiel - hier helfen sich alle gegenseitig. Ob die ehrenamtlichen Eltern von Spieler:innen, die den Ticket- und Getränkeverkauf übernehmen oder die Spieler:innen, die sich gegenseitig beim Aufbau unterstützen.
Das Besondere am Rollstuhl-Basketball: Hier spielen alle miteinander auf dem Platz. Unabhängig von Gender oder Grad der Behinderung können alle, auch Menschen ohne eine körperliche Behinderung, miteinander spielen. Für einen Ausgleich zwischen den Teams sorgt dabei ein Punktesystem, wobei jeder:m Spieler:in je nach Grad der Behinderung Punkte zugeordnet werden. Menschen mit einem hohen Grad der Behinderung kriegen einen Punkt und mit einem niedrigen oder keiner Behinderung den Höchstpunktestand von 4,5. Insgesamt darf ein Team, dass aus fünf Spieler:innen besteht, nicht mehr als 14 Punkte haben.
Im Kader der Dolphins spielen insgesamt 13 Spieler:innen zusammen, wovon die Hälfte Vollzeit und die andere Hälfte nebenher arbeitet. Dabei ist der Trainingsplan für alle gleich, mit bis zu fünfmal die Woche Training plus Fitnessstudio. Das intensive Training zeigt sich auch im Spielerfolg der Dolphins: Auch wenn diese Saison immer noch besser laufen könnte, wurde der Beinahe-Abstieg der vorherigen Saison erfolgreich verhindert. Auch wenn die Dolphins das Spiel bei unserem Besuch gegen den BBC Münsterland leider mit 50 zu 62 verloren, gewannen sie doch im letzten Heimspiel des Jahres 2022 gegen die Hot Rolling Bears Essen und konnten so siegessicher in die Weihnachtspause gehen.
Wir im FairWeg-Team sind angefixt vom Rollstuhl-Basketball. Die eingeschweißte Fan-Gemeinde sorgt für eine aufgeladene Stimmung während der Spiele, während die Dolphins quasi über das Feld fliegen. Schon bereits die rasante Einfahrt der Spieler:innen und die Begrüßung des gegnerischen Teams sehen beeindruckend aus. Ab Anpfiff des Spiels erhöht sich die Geschwindigkeit und Spieler:innen sowie Ball rasen quasi nur so über das Feld. Dabei fliegt nicht nur der Ball über das Feld, sondern teilweise auch Spieler:innen bei besonders intensiven Spielzügen zu Boden. Genau dann merkt man aber die allgegenwärtige menschliche Nähe: Egal ob gegnerische Spieler:innen oder aus dem eigenen Team, es wird sich gegenseitig beim Aufstehen wieder geholfen. Denn Rollstuhl-Basketball ist „im Prinzip der inklusivste Sport, den es gibt!“ wie Miriam Maile sagt, die Medienzuständige des Vereins.
Und wer das nächste Spiel der Doneck Dolphins nicht verpassen will, kann entweder in die Halle zum nächsten Heimspiel am 14. Januar ab 18:00 Uhr gegen den RSV Lahn-Dill kommen oder sich den Livestream im OK54 ansehen. Wir als Team werden die Saison weiterverfolgen und auf die Siege der Dolphins hoffen, denn wir sind begeistert von diesem Sport und vor allem von den Dolphins. Nur durch das Aufbrechen der Verbesonderung, kann Rollstuhl-Basketball als das wahrgenommen werden, was es ist: eine Sportart. Und eine ziemliche erfolgreiche, denn schließlich gibt es nur einen Erstligisten in Trier und das sind die Doneck Dolphins.



Im Projekt Agenda-Kino zeigt die Lokale Agenda 21 Trier gemeinsam im Kooperation mit dem broadway filmtheater und der Heinrich-Böll-Stiftung RLP Filme, die über den eigenen Tellerrand hinnaus blicken und unter die Haut gehen. Im Projekt FairWeg dürfen wir diese Jahr den Auftaktfilm am 18. Januar zeigen: Die Dokumentation "Kinder der Utopie" von Hubertus Siegert gibt Einblicke in Inkusion in deutschen Schulen. Als Kooperationspartner konnten wir den Behindertenbeirat der Stadt Trier für das Nachgespräch gewinnen.
Der Film "Kinder der Utopie" zeigt das Wiedersehen von sechs jungen Erwachsenen, die gemeinsam in einer Inklussionsklasse während der Grundschulzeit waren. Sie besuchten die Fläming-Grundschule in Berlin, die zu der Zeit mit eine der ersten Inklusionsklassen hatte. Hier wurden Kinder mit und ohne Behinderung unterrichtet und das auch unabhängig vom Grad der Behinderung.
Bereits 2004 wurde die Klasse mit Kamera begleitet für den Film Klassenleben. Gemeinsam blicken sie in "Kinder der Utopie" zurück auf die gemeinsame Schulzeit und geben Einblicke in ihr heutiges Leben: Luca ist leidenschaftliche Hobbyfotografin und studiert Umweltwissenschaften; Marvin jobbt zu seinem Ärger in einer Behindertenwerkstatt; Dennis ist auf dem besten Weg, ein Star am Musical-Himmel zu werden; Johanna lernt mit Entschlossenheit Altenpflegerin; Christian befindet sich seit seinem schwulen Coming-Out in einer Selbstfindungsphase; Natalie will ihr Praktikum als Küchenhilfe in eine Festanstellung wandeln.
Der Film startet um 19.30 Uhr im broadway filmtheater. Nach der Filmvorführung steht der Behindertenbeirat und wir vom FairWeg-Team als Gesprächspartner:innen bereit. Tickets können hier bereits vorbestellt werden.